Keine Spannungen aufkommen lassen


Grossformatige Parkett-Dielen liegen im Trend – können aber empfindlicher auf Klimaschwankungen reagieren.Bild: Mafi GmbH


Grossformatige Parkett-Dielen liegen im Trend – können aber empfindlicher auf Klimaschwankungen reagieren.Bild: Mafi GmbH
Parkett. Obwohl klare Vorgaben für den Einbau von Parkettböden definiert sind, kommt es immer wieder zu teuren Schadenfällen. Ein kritischer Faktor dabei ist oft das Raumklima in Verbindung mit der Holzausgleichsfeuchte im Parkett.
Wenn der Frühling kommt, bedeutet dies meistens etwas weniger Arbeit für die Parkettexperten der Interessengemeinschaft der Schweizer Parkett-Industrie (ISP). Denn in den Wintermonaten herrscht in der Regel Hochkonjunktur für Expertisen. Die Heizperiode bringt verschiedenste Schäden am Parkett schonungslos hervor: «Aufgrund des milden Winters blieb es in diesem Jahr jedoch relativ ruhig», bilanziert Beni Lysser, Leiter Technik und Oberexperte der ISP.
Häufige Ursache oder zumindest ein Teil des Problems ist das Raumklima im Zusammenhang mit der Feuchte der Holzbeläge. In der Schweiz geht man von einem üblichen Raumklima mit einer Temperatur zwischen 15 und 30 °C sowie einer relativen Luftfeuchte zwischen 30 % und 70 % aus. Wer im Berufsschulunterricht aufgepasst hat, weiss, dass bei 30 % die Ausgleichsfeuchte im Holz etwa 5 bis 6 % und bei 70 % 12 bis 13 % beträgt. Diese Angaben sind bekannt und finden sich in den geltenden Normen SIA 180 «Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau», SIA 253 und 118/253 «Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz», SIA 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen» sowie dem BAG-Merkblatt «Luftbefeuchter».
Relativ neu hingegen ist die Bestimmung 6.4.2 in der Norm SIA 180, welche besagt: «In Höhenlagen über 800 m ü. M. reduzieren sich die Untergrenze und die Obergrenze um 1 % r. F. pro 100 m. Auf einer Höhe von 1800 m ü. M. liegt der Bereich z. B. zwischen 20 % und 60 % r. F.» Entsprechend niedriger liegt dann auch die Holzausgleichsfeuchte, Parkett für höhere Lagen müsste folglich weiter heruntergetrocknet werden. Bei der Holzplatten AG in Samstagern SZ achtet man in solchen Fällen darauf, dass das Massivparkett 6 bis 8 % Feuchtigkeit aufweist statt der üblichen 7 bis 11 %. «Vorausgesetzt, wir werden vom Schreiner oder Bodenleger bei der Bestellung auf diese spezielle Situation hingewiesen», erzählt Jürg Künzler. Er ist Leiter des Bereiches Bodenbeläge des Holzwerkstoffhändlers und hat die Erfahrung gemacht, dass diesem Aspekt in der Praxis manchmal zu wenig Beachtung geschenkt wird. Da Massivparkett allgemein etwas mehr Fingerspitzengefühl benötigt und das Volumen relativ klein ist, wird in Samstagern die Feuchtigkeit bei jeder Lieferung separat gemessen.
Weit weniger problematisch gestaltet sich die Verwendung von Mehrschichtparkett. Dies hat einerseits mit dem Aufbau zu tun, andererseits aber auch mit dem Hersteller. «Wir kennen unsere Lieferanten aus der Industrie und führen immer wieder Stichproben durch. Nur ganz selten haben Mehrschichtparkette eine Feuchtigkeit von über 7 %», erzählt Jürg Künzler. Generell lässt sich sagen, dass dies auf die meisten Hersteller aus den Alpenregionen zutrifft. Sie sind aufgrund der lokalen Gegebenheiten ohnehin stärker sensibilisiert, was die Feuchteproblematik angeht. Vorsicht geboten ist bei Herstellern aus Fernost oder beispielsweise auch Frankreich. Also überall, wo ganzjährig ein feuchteres Klima herrscht als in der Alpenregion. Denn diese Parkettproduzenten konditionieren ihre Produkte logischerweise für die dort vorherrschenden Klimabedingungen. Nicht unterschätzen darf man ausserdem die Wahl der Holzart. Buche oder Ipé sind bekannt für ihr unruhiges Schwind- und Quellverhalten. Da kommt den Verarbeitern der fortwährende Eichentrend entgegen. Ihr gutmütiges Verhalten macht nicht nur die Verarbeitung einfacher, sondern hat auch erst die grossformatigen, rustikalen Dielen ermöglicht. Beim Mehrschichtparkett empfiehlt Künzler, auch die verwendeten Furniere einmal genauer unter die Lupe zu nehmen: «Messerfurniere zeigen sich eher etwas toleranter gegenüber Klimaschwankungen als Schälfurniere.»
Künzler stellt allerdings klar: «Auch im Unterland herrscht in manchen Räumen ein Klima wie im Engadin.» Verschiedenste Expertisen zeigen immer wieder, dass das Normklima bei Weitem nicht eingehalten wird. Im Winter unterschreitet die relative Luftfeuchte in den Räumen in vielen Fällen die Untergrenze von 30 %. Gemessene Raumluftfeuchten von 20 % und weniger sind dabei keine Seltenheit. Die Holzausgleichsfeuchte liegt dann bei etwa 3 bis 4 %, Spannungsrisse und völlig verzogene Dielen sind hier schon fast vorprogrammiert.
Verantwortlich dafür ist falsches Nutzungsverhalten der Bewohner oder ungenügend geplante und schlecht eingestellte Bodenheizungen sowie Komfortlüftungen. Ein stetiger Luftaustausch bei hohen Raumtemperaturen führt sehr schnell zu trockener Raumluft. Eine Anpassung der Raumtemperatur und der Einstellungen der Komfortlüftung können dann schon einiges bewirken. Denn oft werden diese beim Einbau nach Standardberechnungen eingestellt und später nicht nachjustiert. Diese Massnahme reicht jedoch nicht immer aus, und die Luft müsste dann zusätzlich befeuchtet werden. Bei Bodenheizungen gilt es ausserdem zu beachten, dass gemäss SIA-Norm die Oberflächentemperatur des Parketts 27 °C nicht überschreiten darf. «Das kann insbesondere bei Renovationen ein Thema sein», erzählt Jürg Künzler aus Erfahrung. War zuvor zum Beispiel ein Teppich verlegt, muss nach dem Einbau des Parketts die Bodenheizung neu eingestellt werden.
In diesem Zusammenhang unterschätzt werden vielfach die sogenannten Leerstandschäden. Diese entstehen, wenn eine Wohnung oder ein Gebäude für längere Zeit nicht bewohnt ist – ein Umstand, der insbesondere auf Ferienwohnungen in Berggebieten zutrifft. Aufgrund der fehlenden Nutzung wird noch weniger Feuchtigkeit durch Kochen, Duschen und die Personen selbst an die Innenraumluft abgegeben. Innert kürzester Zeit sinkt dann die Raumluftfeuchte und somit die Holzausgleichsfeuchte stark ab. Umso wichtiger ist es hier, die Eigentümer von wenig oder nicht bewohnten Wohnungen aufzufordern, die Raumtemperatur zu senken und die Komfortlüftung zu drosseln oder auszuschalten.
Kaum einen Einfluss auf die Holzausgleichsfeuchte im Parkett hat übrigens die Oberflächenbehandlung. «Eine Versiegelung kann ein Austrocknen höchstens etwas verzögern», sagt ISP-Oberexperte Beni Lysser dazu. Denn über die Fugen und Stösse findet dennoch ein Feuchtigkeitsausgleich statt.
Mit dem Einbau von hochwertigem und auf die entsprechenden Verhältnisse konditioniertem Parkett ist es also nicht getan. Ebenso entscheidend ist der Informationsfluss in der Planungsphase und dass später auch die Nutzer richtig informiert werden. Natürlich könne man sich im Schadenfall auf die geltenden Normen berufen, sagt Jürg Künzler. «Aber man muss auch an das Image von Parkettböden denken.» Denn egal, was letztendlich die Ursache war – wer einmal grossen Ärger mit Holzbelägen hatte, wird dies auch in seinem Umfeld erzählen. Dadurch kann dann durchaus der eine oder andere potenzielle Parkettkunde verloren gehen.
Merkblätter zum Thema, die auch an Endkunden abgegeben werden können, stehen bei den Holzwerkstoffhändlern und der ISP gratis als Download zur Verfügung.
www.parkett-verband.chwww.holzplatten.chwww.mafi.comVeröffentlichung: 28. April 2016 / Ausgabe 17/2016
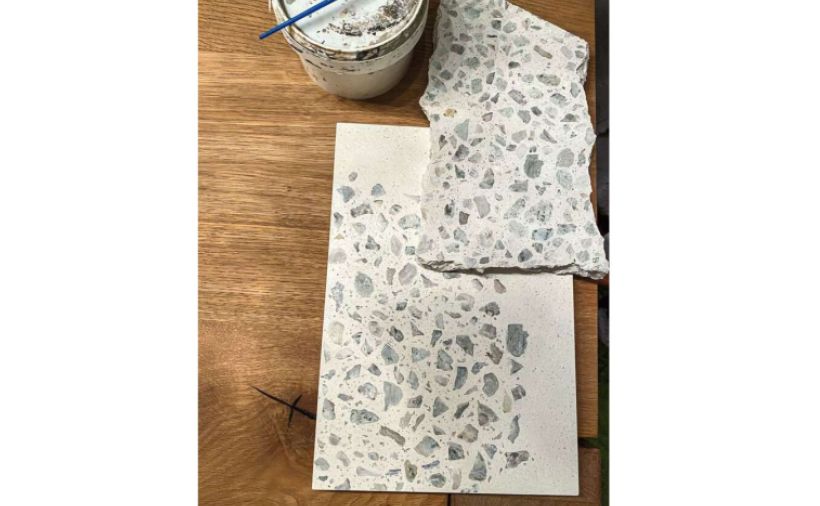
Reparatur. Beschädigungen und Kratzer sind schnell entstanden und ruinieren nicht selten eine ansonsten makellose Oberfläche. Bei fest verbauten Bauteilen ist ein Ersatz oftmals teuer, aufwendig oder schlicht nicht möglich. Eine Alternative kann ein baukosmetischer Eingriff sein.
mehr
Bodenprofile. Übergänge zu anderen Bodenbelägen oder unter Parkettfeldern selbst stellen hohe Anforderungen an die Optik und technische Umsetzung. Um Schäden zu vermeiden, muss von der Planung über die Vorbereitung bis hin zur Montage einiges beachtet werden.
mehr
PaidPost. Die Admonter Holzindustrie AG setzt in vielerlei Hinsicht auf Fortschritt. Einerseits mit einigen Neuheiten im Produktbereich, andererseits auch in der Entwicklung neuer Visualisierungskonzepte auf digitaler Basis.
mehr